
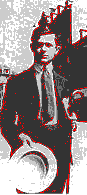
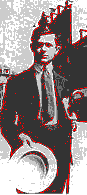
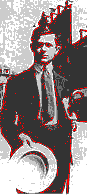
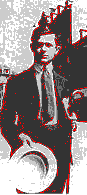
Š Tages-Anzeiger; 19.05.2004;
Seite 58
Kultur
GESCHRIEBEN IN ZÜRICH
Monsieur
Tzara, Provokateur aus Moinesti
Tristan Tzaras Dada-Manifest von 1918 war
das Fanal des Dadaismus. Es katapultierte den Rumänen ins Zentrum der
europäischen Avantgarde.
Von Barbara Basting
Als André Breton (1896-1966), der
Bannerführer des Surrealismus, 1952 in einer Gesprūchsreihe für
den französischen Rundfunk von André Parinaud auch zu seinen Erinnerungen
an Tristan Tzara und Dada in Paris befragt wurde, äusserte er sich kritisch:
'Ich sage hier nur, dass die Zeitschriften und Dada-Manifestationen unter
Tzaras Einfluss ins Stocken gerieten. Das geschah, weil sie alle demselben
Schnittmuster folgten, das auf das Zürcher Publikum zugeschnitten war
und, wenn ich so sagen darf, im Wechselspiel mit diesem ausgewalzt wurde.
Von innen wie von aussen gesehen, wurden die Manifeste immer stereotyper,
sklerotischer.'
Das ist nicht der einzige harte, ja herablassende
Kommentar Bretons zu Tzara (und zu Dada). Dabei hatte Breton Tzara seit April
1919, nachdem er von dessen sagenhaftem Wirken in Zürich durch Francis
Picabia und Jean Cocteau erfahren und Tzaras 'Manifeste Dada' von 1918 zu
Gesicht bekommen hatte, zunächst heftig umworben; aber schon 1922, im
Jahr von Bretons erstem surrealistischen Manifest, überwarfen sich die
beiden. Breton hatte, abgesehen von kunstideologischen Differenzen mit Tzara
und der Dada-Bewegung überhaupt, das Kernproblem aller Avantgarde-Provokationen
seit Marinettis futuristischem Manifest von 1909 klar erkannt: Die Repetition
konnte ihren Aufmerksamkeitswert nur abschwächen. Vor allem aber wollte
der machtbewusste Breton sich selber an die Spitze der Avantgarde setzen.
Das gelang ihm auch.
Achterbahnfahrt der Gedanken
Dabei war Tzaras sympathisch leichtfüssiges
'Manifeste Dada', anders als Marinettis Vorbild, keineswegs nur dummdreiste
Provokation. Schon das kürzeste Zitat belegt dies: 'Wir anerkennen keine
Theorie. Wir haben genug von den kubistischen und futuristischen Akademien:
Laboratorien für formale Gedanken. Macht man Kunst, um Geld zu verdienen
und die netten Bürger zu streicheln?'.
Diese Kostprobe ist typisch für das
lūngste, berühmteste und wichtigste von Tzaras sieben Dada-Manifesten,
das er am 23. Juli 1918 im Zunfthaus zur Meisen vorgetragen hatte. Ein Text,
der auf einer irrwitzigen Achterbahnfahrt der Gedanken inhaltlich wie sprachlich
scharf gegen Konventionen hält; eine Suada, deren Struktur die Demontage
jeder Struktur ist; der als Schwall ketzerischer, frecher, scheinbar konfuser,
aber durchaus nachvollziehbarer Ideen erfrischt. Seine Ventilfunktion für
antibürgerliche Affekte macht ihn zusūtzlich attraktiv. Man wundert sich
kaum, dass er von der Pariser Kunst- und Literaturszene, die sich gerade von
der Katastrophe des Ersten Weltkriegs aufrappelte, gierig aufgesogen wurde.
Dagegen befand die Zürcher Tagespresse
trocken: 'Wer angeregt durch die Pressenotizen aus Deutschland zum Dada ging,
war zweifelsohne enttäuscht. Kein Radau, keine Demonstrationen. War es
die sanfte, zur Monotonie neigende Stimme des Vortragenden, die die Gemüter
der Anwesenden beschwichtigte? War es der Umstand, dass wohl nur wenige der
Anwesenden die französische Sprache so beherrschten, dass sie mit Nachdruck
den Dichter für das Nichtverstehen zur Verantwortung zu ziehen wagten?'
('Zürcher Morgenzeitung', 29. 7. 1918). Mochte Tzara auch kein brillanter
Vortragender sein, eines war er sicher: ein umtriebiger 'Netzwerker', Eventmanager
und Corporate-Identity-Erfinder, um heutige Begriffe zu verwenden. Sein PR-Talent
war beachtlich, folgt man der bisher ersten umfassenden Tzara-Biografie von
Francois Buot (Paris, Ed. Grasset, 2002).
Als Tzara sich aufs Dada-Abenteuer einliess,
ging es für ihn um alles oder nichts. Der am 16. 4. 1896 unter dem Namen
Samuel Rosenstock im rumänischen Moinesti geborene Sohn des Direktors
einer Ölföderfirma stand unter dem typischen Erfolgsdruck des ehrgeizigen
Provinzflüchtlings. Beeinflusst von der Lyrik des französischen
Symbolismus, hatte er sich als Gymnasiast für Sprachexperimente zu interessieren
begonnen. Ab 1915 nennt er sich Tristan Tzara. Dieser wohlklingende Künstlername
ist sein erster poetischer Coup. Er folgt seinem Maler-Freund Marcel Janco
nach Zürich, schreibt sich in der Philosophischen Fakultät ein,
wohnt zunūchst in der Pension Altinger an der Fraumünsterstrasse 21,
die erste in einer ganzen Reihe von Hotels und Pensionen, in denen er während
seiner Zürcher Zeit logiert. Schnell findet er an Hugo Balls Cabaret
Voltaire Anschluss, das er geschickt zu seiner eigenen Plattform ummodelt.
Während Richard Huelsenbeck, Hugo Ball und andere Dadaisten Zürich
wieder verlassen, zieht Tzara die Sache mit der Energie des Verzweifelten,
der keine Alternative sieht, eisern durch.
Ein eklektischer Geist
Tzara, der 1963 in Paris starb, ist aber
anders als Breton nie zum Chefideologen einer Bewegung geworden. Das wūre
wohl seinem eklektischem Geist zuwidergelaufen. Als Lyriker, Romanautor, Kunstkritiker,
Mitglied der Résistance, später Mitglied der französischen
Kommunisten (Lenin hatte er nach eigenem Bekunden in Zürich kennen gelernt,
ohne zu ahnen, wer sein Gegenüber einmal sein würde), Kenner der
afrikanischen Stammeskunst hat er ein umfūngliches Werk, eine erlesene Bibliothek
und Kunstsammlung hinterlassen, die 1968 versteigert wurde. Er gehört
zu den noch immer unterschätzten Figuren des unvergleichlichen Ideenlabors,
das die europäischen Avantgarden der Zwischenkriegszeit waren. Immerhin
hat der Historiker Greil Marcus ihn in seinem Kultbuch 'Lipstick Traces' (1989),
dem Versuch einer alternativen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts, als
Ahnherrn von Punk gewürdigt.
Tristan Tzara: Sieben Dada-Manifeste.
Edition Nautilus, 1998.
Das Kunsthaus Zürich hat aus dem jüngst
versteigerten Nachlass André Bretons ein Album mit raren Dokumenten
zu Dada in Zürich erworben. Es wird im Herbst 2005 im Kunsthaus präsentiert
werden.
BILD KEYSTONE/PHOTOPRESS
Tristan Tzara wird 1917 von Hans Arp
(links) und Hans Richter getragen.
------------------------------------------------------------------------
Mit dieser Suchmaschine haben Sie Zugriff
auf alle in der Schweizerischen Mediendatenbank SMD archivierten Artikel der
gedruckten Ausgabe des 'Tages-Anzeigers', des 'ZüriTipps' und des 'Magazins'.
Fragen und Anregungen zur Suchmaschine: webmistress@tages-anzeiger.ch
------------------------------------------------------------------------
Nutzungsbedingungen
Die Tamedia AG ist Inhaberin der Nutzungsrechte
an den archivierten Artikeln und Fotografien. Das Kopieren, Scannen, Herunterladen,
Vervielfūltigen, Reproduzieren, Verbreiten, Veöffentlichen etc., ob vollstūndig
oder in Teilen, durch Dritte ist nicht gestattet. Die einzelnen Werke dürfen
nur zum Eigengebrauch gemūss Art. 19 Urheberrechtsgesetz (URG) verwendet werden.
In Ausnahmefūllen und auf spezielle Anfrage kann die Chefredaktion ihre Einwilligung
für die Verwendung ausserhalb des Eigengebrauchs unter Angabe der Quelle
und der Autorin/des Autors erteilen. Die Einwilligung zur Verwendung eines
bestimmten Artikels ausserhalb des Eigengebrauchs bedeutet keine Einwilligung
in die Verwertung weiterer Artikel.
------------------------------------------------------------------------